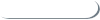Wer
um
Jahrhundertwende
in
England
erfolgreich
Motorräder
verkaufen
wollte
musste
zwangsläufig
Erfolge
im
Motorsport
vorweisen
können.
Das
hatte
auch
die
Firma
Bayliss
&
Thomas
aus
Coventry
schnell
erkannt
als
sie
von
der
Fahrradproduktion
auf
Motorräder
umstieg.
Ein
erster
sportlicher
Erfolg
gelang
Excelsior
im
Jahre
1903
als
Harry
Martin
als
erster
für
die
Meile
58,9
Sec.
brauchte
und
damit
erstmals
unter
eine
Minute
blieb.Die
Firma
wuchs
sehr
schnell
und
änderte
1910
ihren
Firmennamen
in
Excelsior
Motor
Compony
Ltd.,dessen
Markenzeichen
ein
Bergsteiger
mit
schwenkender
Fahne
schmückte.
Nach
dem
ersten
Weltkrieg
verkauften
Bayliss
&
Thomas
Excelsior
an
die
Fa.Walker
in
Birningham
,
wohin
dann
auch
der
Firmensitz
verlegt
wurde.
Da
auch
die
Fa.Walker
ein
Engagement
im
Motorsport
für
äusserst
wichtig
erachtete,
stattete
man
ab
1923
die
Rennmaschinen
mit
dem
erfolgreichen
JAP-Motor
aus.
Ein
besonders
beachteter
Erfolg
gelang
damit
dem
Fahrer
Crabtree
als
er
bei
der
1929er
Tourist-Trophy
mit
neuer
Rekord
Durch-schnittsgeschwindigkeit
von
102,8
km/h
in
der
250
ccm
Klasse
siegte.
Excelsior
Speedwaybikes
mit
JAP-Motoren
wurden
von
1934
bis
Ende
der
fünfziger
Jahre
gebaut
und
waren
sehr
erfolgreich.
Auf
dem
Bild
oben
ist
ein
älteres
Modell
zu
sehen
wobei
das
obere
Rahmenrohr
über
dem
Tank
abgewinkelt
ist
und
zwei
zusätzliche
Rahmenrohre
links
und
rechts
unter
dem
Tank
entlang
führen.
Am
rechten
Rahmenrohr
ist
die
seinerzeit
übliche
Kniestütze
angebracht.
Ungewöhnlich
ist
hier
auch
die
Plazierung
des
Öltanks
am
vorderen
Rahmenrohr
direkt
vor
dem
Motor
nahe
dem
Auspuff,
wodurch
man
wohl
eine
Vorwärmung
des
Öls
durch
die
Motorwärme
erreichen
wollte.
Besonders
grossen
Wert
legte
man
bei
Excelsior
auf
gute
Zugänglichkeit
und
Reparaturfreundlichkeit
von
Motor
und
Getriebe
bzw.Vorgelege.
Dies
erkennt
man
auch
am
unteren
Rahmenrohr
des
Heckteils,
welches
nach
unten
gezogen und dann gerade abgewinkelt wurde um einen problemlosen Ausbau des Vorgeleges zu ermöglichen.
Eine
spezielle
Excelsior
Eigenkonstruktion
war
auch
die
Vordergabel,
welche
bei
den
älteren
MK
2
Modellen
(links
im
Bild)
mit
einem
über
Handrad
einstellbaren
Reibungs-Lenkungsdämpfer
versehen
war.
Der
Lenkkopf
war hier zweigeteilt und seitlich mit zwei kurzen Halterungen für den nach vorn versetzten Lenker versehen.
Spätere
Modelle,
wie
im
Bild
rechts
beim
MK
4
von
1952
zu
sehen,
hatten
einen
einteiligen
Lenkkopf
mit
angegossener Lenkeraufnahme.
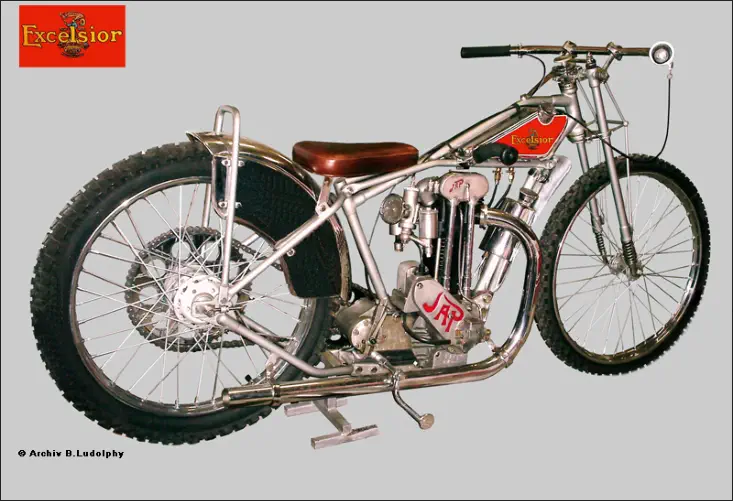

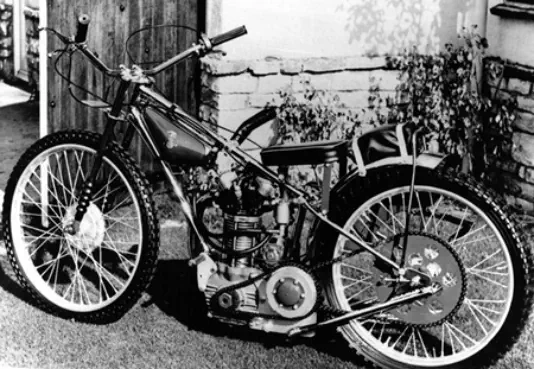

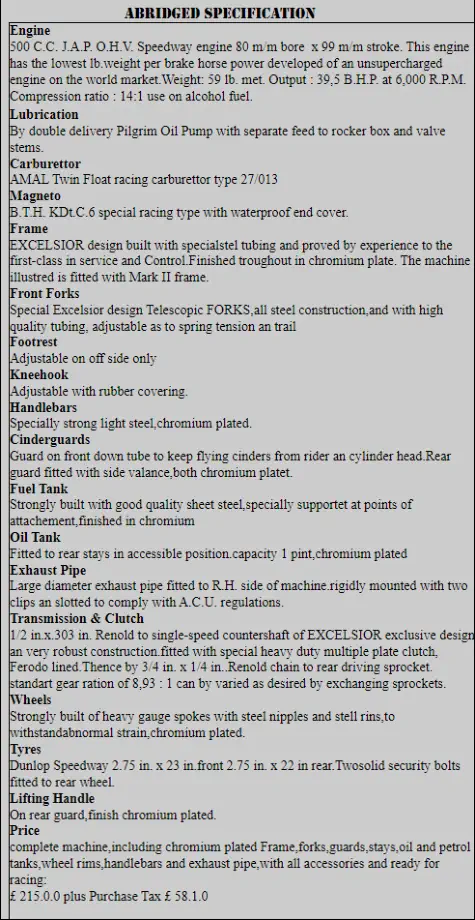

Das
Excelsior
MK
2
Speedwaybike
aus
den
fünfziger
Jahren
hatte
die
Verstrebungen
unter
dem
Tank
nicht
mehr
so
das
der
nun
Oval
geformte
Tank
am
oberen
Rahmenrohr
befestigt
wurde.
Der
Öltank
wurde nach hinten versetzt und auch das untere Rohr des Heckteils war nicht mehr abgewinkelt.
Excelsior
Grasbahnmaschine
mit
5
Bolzer
JAP-Motor
und
gebremsten
Vorder-
und
Hinterrad.
Hier
auch
zu
erkennen
ist
die
FERODO
Kupplung.
Der
Lenkkopfwinkel
ist
hier
nicht
so
Steil
als
beim
Speedwaybike
wodurch
der
Radstand
vergrößert
wird
und
sich
die
Maschine
auf
der
langen
Bahn
wesentlich
ruhiger fahren läßt.

Excelsior
Speedwaybike
mit
HRD
Vincent
Motor
aus
den
1930iger
Jahren
mit
im
Zylinderkopf
hängenden
Ventilen
und
untenliegender
Nockenwelle.
Um
die
Stosstangen
möglichst
kurz
zu halten ist hier die über mehrere Zahnräder angetriebene Nockenwelle weit nach oben ins Motorgehäuse verlegt worden.
Erfolgreichster
Excelsior
Motor
war
der
1935
erstmals
vorgestellte
250
ccm
Manxmann
mit
zwei
Ventilen
und
über
Königswelle
angetriebener
Nockenwelle.
Um
damit
auch
auf
der
Rennstrecke
erfolgreich
zu
sein
baute
man
1936
eine
Vierventilversion
mit
Bronzekopf
womit
Tyrell
Smith
1936
sogar
den
Europmeistertitel
erringen
konnte.
Bis
Ende
der
50er
Jahre
war
dieser Typ noch auf den Rennstrecken Europas anzutreffen.
Im
rechten
Bild
ist
ein
350
ccm
Manxman-Motor
in
seiner
ersten
Ausführung
von
1935
mit
vollverkapselten
Ventilfedern
und
Bronzekopf
zu
sehen.
Leider
konnte
ich
bis
jetzt
noch
nicht
herausfinden
ob
dieser
Motor
auch
im
Speedwaybike
verbaut
wurde.
Als
Excelsior
Firmenchef
Eric
Walker
Ende
der
50er
Jahre
verstarb,
verkauften
kurz
darauf
seine
beiden
Söhne
das
Werk an den Autozulieferer BRITAX, der die Motorradproduktion dann einstellte.

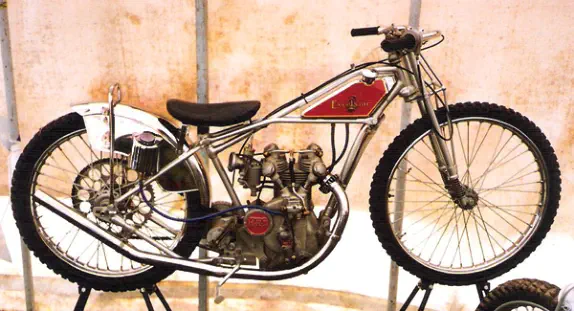


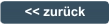

Erich Bertram Story Bahnsporttechnik.de

Erich
Bertram
wurde
1909
in
Dortmund
geboren,
lebte
aber
die
meiste
Zeit
seines
Lebens
in
Berlin.
Dort
machte
er
ab
1923
eine
Lehre
als
Automechaniker
bei
einer
Firma
in
Neukölln.
Von
seinem
erspartem
Geld
kaufte
er
sich
eine
Strassenmaschine
der
Marke
“
Motosacoche”
und
bestritt
damit
als
20
jähriger,
1929
in
Berlin-
Mariendorf
sein
erstes
Rennen.
Von
Anfang
an
mischte
Bertram
vorn
mit
und
konnte
bereits
nach
einem
Jahr
in
der
Ausweisklasse
in
die
Lizenzklasse,
der
damals
höchsten
Klasse,
aufsteigen.
Da
er
keine
Sponsoren
hatte
und
sein
Lohn
als
Automechaniker
nicht
ausreichte
um
seinen
Sport
zu
finanzieren,
nahm
er
eine
besser
bezahlte
Stelle
als
Bauhelfer
an.
In
Abendkursen
machte
er
seinen
Ingenieur
im
Fahrzeugbau.
Mit
seiner
Rennfahrerkarriere
ging
es
aber
erst
richtig
vorran
als
er
sich
nach
vielen
Überstunden
endlich
das
Geld
für
eine
Rudge-Bahnmaschine
zusammengespart
hatte.
So
konnte
er
in
den
Jahren
1930
bis
1935
allein
149
Siege
erringen
und
27
Bahnrekorde
aufstellen.
1934
gewann
er
den
Goldhelm
von
Deutschland
auf
der
Bahn
in
München-Daglfing.
In
ganz
Europa
feierte
Bertram
in
den
nächsten
Jahren
große
Erfolge,
sogar
in
der
Rumänischen
Hauptstadt
Bukarest
kann
er
mit
106,9
km/h
einen
neuen
Bahnrekord
aufstellen.
Bertram
startete
dabei,
dank
großzügiger
Unterstützung
des
Berliner
Rudge-
Importeurs
Friedrich
Brumm,
stets
in
mehren
Klassen
und
brachte
1937
das
Kunststück
fertig
beim
Teterower
Bergringrennen
in
den
Klassen
250
ccm
,
350
ccm
und
500
ccm
jeweils
den
ersten
Platz
zu
belegen,
wobei
er
in
der
350er
Klasse
den
bis
kurz
vor
dem
Ziel führenden Herrmann Gunzenhauser auf der Zielgeraden noch abfangen konnte.
Foto
links
:
Erich
Bert-
ram
auf
seiner
Rudge
wieder einmal siegreich.
Foto
rechts:
Bertram
Fahrgestell
mit
500
ccm
Jap Motor




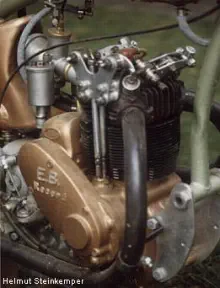
Die von Bertram in den achtziger und neunziger Jahren oft ausgestellte 350er Rudge mit der Nr.13 und vollradialer Ventilsteuerung.



Bertram-Record
-Langbahnmaschine
mit
Rudge-Motor
und
2-Ventil
Horex-
Zylinderkopf.
Der
Motor
befindet
sich
in
einem
englischen
BRM-Langbahnfahrgestell
aus
den
achtziger
Jahren.
Nach
seinem
Karriereende
1954
stand
für
Erich
Bertram
seine
berufliche
Existenz,
mit
dem
Aufbau
eines
MAZDA-Autohauses
an
der
Braunschweiger
Strasse
in
Berlin,
in
den
Vordergrund.
Erst
als
er
in
den
Ruhestand
ging
und
1983
nach
Bayern
übersiedelte
begann
er
wieder
sich
im
Bahnsport
zu
engagieren.
So
schuf
er
1987
das
“Erich
Bertram
Motor
Racing
Team
“
mit
dem
Ziel
junge
talentierte
Nachwuchsfahrer
mit
Geld
und
auch
mit
seiner
grossen
Erfahrung
zu
unterstützen.
Seinem
Team
gehörten
Gerd
Riss,
Georg
Limbrunner,
Markus
Jans
und
Hans
Faltermeier
an,
die
in
der
Folgezeit
auch
einige
Erfolge
einfahren
konnten.
1990
schuf
er
die”
EBM-Trophy”,
ein
Rennen
in
Plattling
an
dem
die
besten
Deutschen
B-Lizenzfahrer
teilnahmen.
Erster
Gewinner
war
der
Bahnpokalsieger
von
1989
Uwe
Fienhage
aus
Lohne
.
Ab
der
Grenzöffnung
1990
verlegte
Bertram
seine
aktivitäten
überwiegend
nach
Ostdeutschland,
so
das
nur
noch
Georg
Limbrunner
(Foto
links)
als
einzigster
westdeutscher
Fahrer
unterstützt
wurde.
Bertram
lies
bei
Tuner
Anton
Nischler
ein
spezielles
Langbahnfahrgestell
mit
GM-Motor
bauen,
mit
dem Limbrunner es 1990 bis in Langbahn Weltfinale schaffte.
Später lebte Erich Bertram in der Nähe von Teterow wo er 1994 im Alter von 85 Jahren verstarb.



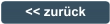

Gerhard Pabst Story Bahnsporttechnik.de
Pabst
Gerhard
aus
Straubing
(geb.1940),
wurde
in
den
fünfziger
Jahren
durch
die
in
seiner
Heimatstadt
stattfindenden
Sandbahnrennen
mit
dem
Bahnsportvirus
infiziert.
Der
Werkzeugmachermeister
fuhr
zunächst
Anfang
der
1960iger
Jahre
Sandbahnrennen
in
der
Ausweisklasse.
In
der
damaligen
Zeit
nicht
war
es
nicht
so
einfach
einen
Startplatz
zu
bekommen,
mußte
man
sich
doch
oft
bei
Ausscheidungsläufen
im
Training
gegen
viele
Mitbewerber
für
das
Rennen
qualifizieren.
Bei
den
Rennen
selbst
standen
dann
nicht
selten
oft
bis
zu
16
Fahrer
pro
Lauf
gleichzeitig
am
Startband
um
dann
bis
zu
6
Runden
zu
fahren.
Das
ging
besonders
an
den
Verschleiß
der
empfindlichen
Jap-Motoren
ebenso
wie
an
die
körperliche
Substanz.
Doch
durch
die
Liebe
zum
Sport
vermochte
er,
wie
die
Behebung
von
Maschinenschäden
oder
die
Bewältigung
von
Stürzen,
immer
positiv
zu
bewältigen.
1965
erhielt
er
die
nationale
-
ein
Jahr
später
die
internationale
Lizenz.
Durch
die
damals
schier
übermächtige
Konkurrenz
(siehe
z.B.
die
Starterliste
vom
BBM
München
1966)
war
es
seinerzeit
schon
ein
großer
Erfolg
bei
großen
namhaften
Veranstaltungen
den
Tagesendlauf
oder
gar
einen
Podiumsplatz
zu
erreichen.
Er
erzielte
sowohl
in
der
Ausweis-
auch
in
der
Lizenzklasse
so
manche
erfreuliche
Plazierungen bei den damals in den 60iger Jahren, noch vielen Sandbahnrennen im gesamten süddeutschen Raum.
Bedingt
durch
berufliche
Weiterbildung
und
Familie
machte
er
dann
1967
mit
dem
Bahnsport
vorerst
Schluß.
Als
sich
1991
in
Olching
einige
ehemalige
Fahrer
zu
Demorunden
bei
einen
Speedwayrennen
trafen,
fand
er
seine
Liebe
am
Bahnsport
wieder
zurück.
Er
war
Mitbegründer
der
Interessengemeinschaft
ehemaliger
Bahnfahrer
der
1.deutschen
Oldie-Fahrervereinigung
im
Jahr
1995
und
von
2000
bis
2005
deren
1.Vorstand.
Im
Jahr
nahm
er
mit
seiner
historischen
Jap
und
Jawa
oft
an
bis
zu
15
Rennen
in
Deutschland
und
im
euro-päischen
Ausland
an
Speedway-Sand-
und
Grasbahnrennen
in
der
Oldieklasse
teil
und
wurde
u.a.1996
der
erste
Meister
der
OFV.
Hier
erlebte
der
Straubinger
ein
erfolgreiches
Comeback
was
aber
nach
einem
unverschuldeten
Unfall
beim
Rennen
im
Jahr
2000
auf
der
Sandbahn
in
Marienbad
zu
Ende
ging.
Seine
gepflegten
Rennmaschinen
stehen
nun,
die
er
jetzt
wieder
so
halbwegs
genesen,
bei
einigen
Demo-Veranstaltungen
noch
gerne
zeigen
und
laufen
läßt,
immer
startklar
in
seiner
Garage.
Jedoch
freut
er
sich
aber
nach
50jähriger
Berufstätigkeit
am
Ruhestand
und
seiner
Familie,
besucht
gerne
immer
noch
einige
Rennen
um
auch
Freunde
und
Bekannte
aus
der
Szene
zu
treffen.
Sonst
beschäftigt
er
sich
mit
der
Historie
von
Fahrern
und
Maschinen
aus
den 1930er - 1960er Jahren im Motorrad-Bahnsport von Deutschland und Österreich.






Mühldorf 1961
- Start der Ausweisklasse bis 500 ccm
4
Haindl
Ludwig
(Unterhaching),
5
Brunhirl
Siegfried
(Ismaning),
12
Unterholzner
Josef
(Flossing),
2
Pabst
Gerhard
(Straubing),
3
Kiesslich
Horst
(Straubing),
11
Eichhorn
Christoph
(Ebersberg),
9
Wittmer
Wolfgang
(Dellfeld),
8
Wagner
Richard
(Haunstetten),
9
Odermatt
Pius
(Schifferstadt),
10
Kroiß
Horst
(Pilsting),
13
Holzmann
Franz
(Marktoberdorf),
14
Dörr
Alfred (Heggen)


Siegerehrung
beim
Fritz
Dirtl
Gedächtnisrennen
in
Pfarrkirchen
1966,
Nr
10
Max
Hörmann
(Kempten).
Nr
24
Gerhard
Pabst
(Straubing),
Nr
21
Johann
Antholzer
(Perach).
Anfängerschicksal
:
1963
Sturz
in
der
Ausweisklasse
in
Pocking.
Man
beachte
auch
wie
nah
die
Zuschauer an der Bande stehen
Flaggschiff
der
Maschinen
von
Gerhard
Pabst
ist
seine
Langhub-Jap
im
Hofmeister-
Fahrgestell,
(gebaut
ca.
1958
von
Fred
Aberl
),
mit
einem
Norton
Getriebe
was
auf
2
Gänge
umgebaut wurde.
Gerhard Pabst mit seiner JAP im Rahmen der Oldie-Serie in Mühldorf 1999


Beeindruckende
Fahrervorstellung
beim
internationalen
Sandbahnrennen 1966 in Pfarrkirchen
1.
Reihe
von
re.
n..lks.
:1
Poschenrieder
Manfred
(Kempten),
2
Godden
V.
Don
(England),
3
Seidl
Josef
(München),
4
Aberl
Fred
(Mühldorf),
5
Ödegard
Jon
(Norwegen),
6
Lantenhammer
Otto
(Moosmühle),
8
Sprenger
Heinrich
(Bad
Wiesee),
10
Hörmann
Max
(Kempten),
2.
Reihe
von.
re.
n.
lks.
:
15
Jüngling
Rainer
(Sulzberg),
16
Unterholzner
Josef
(Flossing),
17
Wiesent
Seb.
(Gröbenzell),
18
Sondermeier
Seb.
(Dorfen),
19
Halter
Helmut
(München),
21
Antholzer
Johann
(Perach),
23
Aigner
Josef
(Oberpfaffenhofen),
24
Pabst
Gerhard
(Straubing).


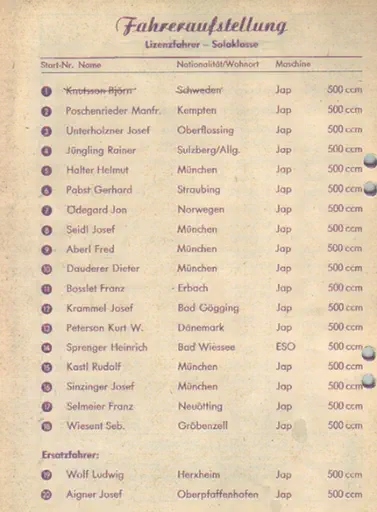
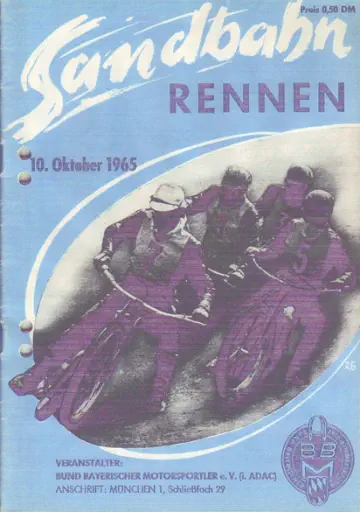
Starterliste
des
Sandbahnrennens
im
BBM
Stadion
München
im
Jahre
1966
mit
Namen
die
auch
heute
noch
das
Herz
jeden
Bahnsportfans
höher
schlagen
lassen.
Mit
dabei
unter
anderen
die
Europameister
Jon
Ödegard,
Manfred
Poschenrieder,
K.W.-
Petersen

Foto
oben
rechts:
Gerhard
Pabst
auf
der
Sandbahn
in
Plattling
1966
in
der
Ausweisklasse
Foto
links:
Langbahnmaschine
Jawa
895
im
Godden
Fahrgestell
mit
Jawa
Zweiganggetriebe von 1978
Foto rechts:
500
ccm
Jap
(Kurzhub)
Speedway-
maschine
von
Baujahr
1968
im
Jawa
-
Fahrgestell eingebaut
Gerhard
Pabst
starb
am
4.April
2021,
einen
Tag
vor
seinem
81.
Geburtstag.
Im
Jahre
2013
sandte
er
mir
die
hier
gezeigten
Bilder
und
nach
einigen
telefonaten
entstand
dann
dieser
Bericht mit dem ich hier die Erinnerung an einen phantastischen Rennfahrer wachhalten will. Ruhe in Frieden Gerhard.

Herrmann Bernhard Schwenker Bahnsporttechnik.de


In
den
sechziger
Jahren
des
vergangenen
Jahrhunderts,
also
zur
Blütezeit
der
Gespannrennen
in
Deutschland
dominierten
Fahrer
aus
Südwestdeutschland
den
Gespannsport
.Es
gab
Bahnen
in
Kaiserslautern,
Altrip,
Hassloch,
Herxheim,
Homburg
(Saar),
Webenheim
(Saar),
Zweibrücken
und
so
war
es
nicht
verwunderlich
das
fast
alle
Fahrer
mit
Rang
und
Namen
aus
dieser
Region
kamen.
Kolb,
Feindel,
Magin
aus
der
Vorderpfalz.
Schneckenberger,
Luthringshauser,
Bernhard
(mit
Beifahrer
Jack
Green
aus
den
USA)
aus
der
Hinterpfalz,
Später
gesellte sich Heilig dazu. Dann die Frankfurter Mertinke und die vielen Fahrer aus Bayern.
Bernd
Kroemer
,
lange
Zeit
Mitarbeiter
bei
“Bahnsport
Aktuell
“und
heute
in
Namibia
heimisch
geworden,
erlebte
diese
glorreiche
Gespannzeit
mit
und
stellte
mir
freundlicherweise
einige Bilder von damals zur Verfügung.
Hier
einige
Bilder
von
Herrmann
Bernhard
aus
Zweibrücken
der
mit
Beifahrer
Scherer
im
Boot,
bzw.wie
man
damals
sagte
an
der
Kurbel,
unterwegs
war.
Das
linke
Bild
zeigt
die
beiden
1967 auf einer Grasbahn voll in Action und rechts im Siegerkranz. Das rechte Foto zeigt Herrmann Bernhard mit Beifahrer Scherer nach ihrem Sieg in Zweibrücken 1967.
Die
Gespanne
wurden
von
Hans
Schneckenberger
aus
Kaiserslautern
gebaut,
der
selbst
einige
Jahre
aktiver
Gespannfahrer
war.Sie
waren
mit
BMW
R51
und
R75
Motoren
ausgerüstet.
Das
R75
Gespann
befindet
sich
heute
im
Zweiradmuseum
von
Heinz
Luthringshauser
in
Otterbach,
welches
sich
in
einer
ehemaligen
Kirche
befindet.
Luthringshauser
war
selbst
leidenschaftlicher
Rennfahrer
sowohl
auf
der
Sandbahn
als
auch
auf
der
Strasse
und
im
Jahre 1970 Deutscher Meister in der 500 ccm Seitenwagenklasse.
Ebenfalls
im
Luthringshauser
Museum
befindet
sich
das
auf
dem
mittleren
und
rechten
Foto
zu
sehende
BMW-Schwenkergespann
des
Frankfurters
Walter
Mertinke
der
von
1953
bis
1970
im
Gespannsport
aktiv
war.
Bei
diesem
Gespann
handelt
es
sich
um
ein
echtes
Kneeler-Gespann
bei
dem
Unterschenkelauflage,
Tankverkleidung
,Sitzbank
und
Hinterradverkleidung
bereits
aus
Glasfieberguss
bestehen.
Bild
unten
links:
Walter
Mertinke
mit
selbstgebautem
BMW-Schwenkergespann
und
Beifahrer
Ernst
Schröder
1963
auf
der
Grasbahn
in
Schwarme.
Mertinke,
der
bereits
1952
eine
heute
noch
existierende
BMW-
Vertretung
in
Frankfurt
Heddernheim
übernahm,
fuhr
stets
nur
BMW
angetriebene
Schwenker
im
Eigenbau
Fahrgestell
mit
denen
er
sowohl
in
der
500
ccm
als
auch
in
der
750
ccm
Klasse
mehr
als
hundert
Tagessiege erringen konnte.
Bild
rechts:
Bereits
1955
gab
es
erste
BMW
Kneeler-
Gespanne
auf
der
Grasbahn.
Die
Gespanne
stammten
damals
hauptsächlich
aus
ehemaligen
Wehrmachtsbeständen
die
von
den
Piloten
oft
in
mühevoller
Kleinarbeit
renntauglich
gemacht
wurden.
Auf
den
Foto
oben
sind
vorn
Eduard
Niemöller
und
hinten
Helmut
Mairose
vom
MSC
Goldina
am
Start
zu
sehen.
Anders
als
bei
den
späteren
Gespannen
befindet
sich
hier
der
Beiwagen an der linken Seite.





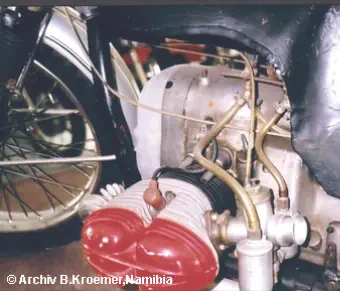



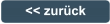

Fritz Horberth Gespanne Bahnsporttechnik.de
Der
Bremer
Fritz
Horberth
begann
seine
erfolgreiche
Motorsportkarriere
im
Jahre
1950
als
Solofahrer,
wobei
er
sowohl
bei
Sand-und
Grasbahn
als
auch
bei
Straßenrennen,
meistens
mit
einer
250ccm
NSU-
OSL
,
an
den
Start
ging.
1957
ging
Fritz
Horberth
erstmals
in
der
Gespannklasse
an
den
Start.
Mit
einem
von
Dieter
Schicke
gebauten,
“Gartenstuhl”
genannten,
Linksgespann
mit
Seitenwagenradantrieb
(
Bild
links)
fuhr
er
von
Anfang
an
meistens
vorneweg,
was
die
Konkurrenz
natürlich
gar
nicht
lustig
fand,
da
sie
einen
doppelten
Strahl
ab
bekam.
Um
in
den
Kurven
ein
geradeaus
driften
des
Gespanns
zu
verhindern,
war
der
Seitenwagenradantrieb
mit
einem
Freilauf
versehen.
Die
Erfolge
des
Fritz
Horberth
waren
auf
seine
penible
Vorbereitung
zurückzuführen
.So
waren
Zettel
und
Bleistift
sein
wichtigstes
Werkzeug,
denn
die
richtige
Übersetzung
war
für
ihm
das
A
und
O.
Schon
damals
zog
er
bei
seinen
Überlegungen für die richtige Übersetzung die Beschaffenheit der Bahn, die Witterungsverhältnisse u.s.w. mit ein. Alles Sachen die seinerzeit noch lange nicht selbstverständlich waren.
z

© Harro Esmach

Das
Bild
zeigt
Fritz
Horberth
(39)
mit
Beifahrer
Dieter
Schicke
1957
in
Hamburg-
Farmsen
wo
sie den dritten Platz belegten.
Das
von
Fritz
Horberth
gebaute
„Gartenstuhl“
Gespann
mit
Linksbeiwagen
und
Seitenwagenradantrieb. Als Seitenwagenrad wurde ein Puch Hinterrad verwendet.
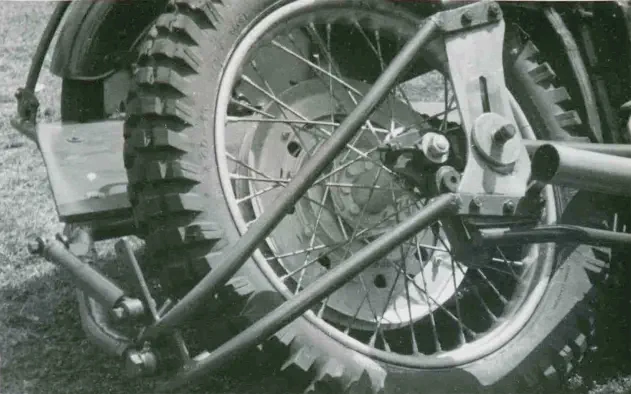

Klappstuhl mit Linksbeiwagen
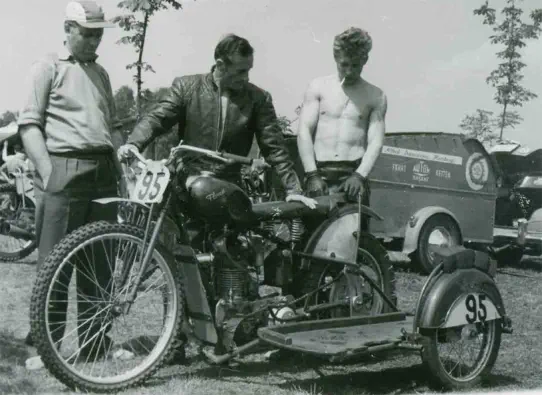
Von
1958
bis
1964
fuhr
Horberth
mit
dem
“Klappstuhl”-Gespann,
wobei
es
sich
um
ein
Links-
Gespann
ohne
Schwenkeinrichtung,
wie
etwa
beim
Schwenkergespann,
handelte,
dessen
Prinzip nicht wie häufig vermutet von Fritz erfunden wurde, sondern (meißt erfolglos) bereits im Strassenrennsport ausprobiert wurde.
© Harro Esmarch
© Harro Esmarch


Der
von
Horberth
gebaute
Klappstuhl
war
eine
Eigenkonstruktion,
mit
den
seiner
Meinung
nach,
optimalsten
Fahreigenschaften
für
den
Bahnsport.
Dabei
sollten
die
Fahreigenschaften
denen
einer
Solo-Maschine
gleichen
wobei
der
Schmiermaxe
fast
passiv
im
Seitenwagen
saß.
Anders
als
beim
Schwenker,
brauchte
er
hier
weder
durch
Kurbeln
noch
durch
Gewichtsverlagerung
Einfluß
auf
die
Kurvenfahrt
nehmen.
Der
Fahrer
allein
entschied
welche
Spur
er
fahren
wollte,
oder
ob
er
innen
oder
außen
überholen
wollte.
Es
bedurfte
keiner
Absprache
oder
sonstiger
Zeichen.
Die
wichtigste
Aufgabe
des
Beifahrers
war
es,
sich
so
klein
wie
möglich
zu
machen
und
nicht
mit
seinen
Körper
die
Schräglage
der
Maschine
vorzeitig
zu begrenzen. Das Linke Bild zeigt den Klappstuhl bei voller Schräglage. Rechts ein Vergleich zwischen Schwenkergespann (vorn) und dem Klappstuhl Gespann.
Klappstuhl Gespann mit Rechtsbeiwagen
Mit
dem
Klappstuhl-Gespann
bestritt
Fritz
Horberth
7
Jahre
erfolgreich
Rennen.
Trotzdem
meinten
einige
Funktionäre
das
es
zu
gefährlich
sei,
so
daß
es
schlieslich
verboten
wurde.
Der
wahre
Grund
lag
wohl
darin
begründet,
das
sich
einige
Funktinäre
nicht
in
Horberths
Erfolgen
sonnen
konnten.
Aber
so
etwas
konnte
einen
Fritz
Horberth
nicht
erschrecken.
1965
brachte
er, zum entsetzen einiger Funtionäre, den neuen Klappstuhl an den Start. Wieder ein flexibles Gespann, allerdings diesmal mit Rechts- Beiwagen und ohne Schwenkmechanismus.
Mit
diesem
neuen
Klappstuhl
gewann
Horberth
mit
Beifahrer
Willehard
Osburg
auf
Anhieb
die
Europameisterschaft
1965
in
Scheessel.
Allerdings
konnte
er
die
Früchte
dieses
Erfolges
nicht lange genießen, denn bei seinem nächsten Rennen wurde er von einen Konkurrenten angefahren und so schwer verletzt, das er seine Karriere beenden mußte.
Klappstuhl Neubau nach Karriereende






Inspiriert
durch
Nostalgie
und
Oldierennen,
wollte
Fritz
Horberth
mit
Dieter
Schicke
1983
wieder
einen
Klappstuhl
bauen,
was
dieser
allerdings
aus
Zeitgründen
ablehnen
mußte.
Da
Fritz
aber
von
Peter
Ernst
wusste,
das
dieser
auch
über
das
erforderliche
Geschick
und
handwerkliche
Können
und
zudem
noch
über
passende
Räumlichkeiten
verfügte,
war
es
nun
an
ihm
nach
Horberths
Anweisungen
und
Ideen
einen
neuen
Klappstuhl
zu
bauen.
Unter
anderen
sollte
das
Seitenwagenrad
im
Verhältnis
zur
Schräglage
des
Motorrades
über
ein
Gestänge
mitlenken
und
über
eine
im
Seitenwagenrad
integrierte
Federung
verfügen,
was
allerdings
nach
Testfahrten
wieder
verworfen
wurde.
So
entstand
innerhalb
von
nur
4
Monaten
ein
völlig
neuer
Klappstuhl
für
dessen
Antrieb
Peter
Ernst
seinen
500
ccm
Jap
zur
Verfügung
stellte.
Bei
einigen
Veranstaltungen
in
den
Jahren
1983/84
ging
Horberth
mit
Peter
Ernst
im
Boot,
im
Rahmenprogramm
an
den
Start.
So
unter
anderen
im
Bremer
Hansa-Stadion,
in
Schwarme
und
Osnabrück.
Auch
sein
alter
Schmiermaxe
Willehard
Osburg
stieg
noch
einmal
in
den
Seitenwagen.
Fritz
hatte
bei
diesem
Projekt
versucht
seine
Ideen
die
er
während
seiner
aktiven
Zeit
nicht
mehr
umsetzen
konnte
zu
verwirklichen
und
steckte
insgesamt
fast
15
000
DM
in
dieses
Projekt.
Auszeichnungen
Auszeichnung mit dem Silbernen Lorbeerblatt des DMV 1964 in Scheessel
Fritz
Horberth
errang
in
seiner
insgesamt
15
Jahre
währenden
Karriere
bei
300
Starts
insgesamt
262
Siege,
sowie
diverse
zweite
und
dritte
Plätze.
Außerdem
war
er
stets
Gau-und
Landesmeister
im
Gau
Weser-Ems.In
der
1964
erstmals
ausgetragenen
Nord-und
Westdeutschen
Bahnmeisterschaft
trug
er
sich
als
erster
in
der
Siegerliste
ein.
Nach
Beendigung
seiner
Laufbahn wurde ihm als große Anerkennung für seine Verdienste im Motorradsport, das große Sportabzeichen mit Brillanten verliehen. Am 8. September 1992 verstarb Fritz Horberth.
Mein besonderer Dank an Herbert Linne, Dieter Schicke,Willehard Osburg und Peter Ernst die durch die Zurverfügungstellung von Text und Bildmaterial zum entstehen dieser Story beigetragen haben
.
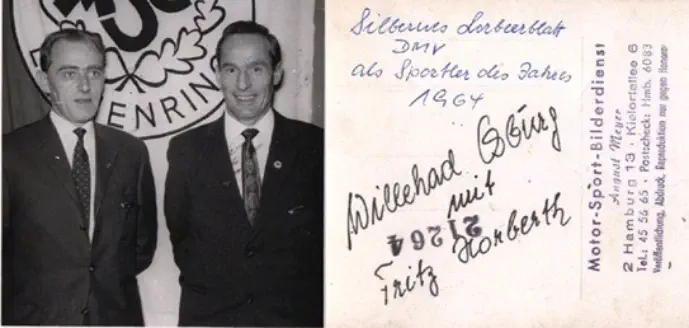


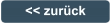

Hofmeister JAP Bahnsporttechnik.de
Josef
Hofmeister
aus
Abensberg
war
zwischen
1958
und
1960
dreimal
hintereinander
Sandbahn
Europameister
und
fing
bereits
in
den
frühen
fünfziger
Jahren
des
letzten
Jahrhunderts
mit
dem
Rahmenbau
an.
Gefertigt
wurden
sie
in
der
Werkstatt
von
Fred
Aberl in Mühldorf.
Hofmeister
selbst
hatte
zuerst
Münzloher
Rahmen
die
ihm
aber
bei
hoher
Geschwindigkeit
und
in
den
Kurven
zu
instabil
waren
weshalb
er
beschloß
eigene
Rahmen
herzustellen.
Hofmeisters
Überlegung
war
dabei,
die
Führungseigenschaften
des
Motorrads,
welche
beim
Münzloher
Fahrgestell
zu
2/3
vom
Vorderrad
und
dem
Front
-
Rahmenteil
bestimmt
wurden,
weiter
nach
hinten
zu
verlegen.
Hofmeister
hat
praktisch
einen
Münzloher
Rahmen
durchgeschnitten
und
dann
mit
verschiedenen
Heckteilen
experimentiert.
Dadurch
enden
die
Rahmenrohre
hinten
erst
unter
dem
Motor,
wodurch
das
Heckteil
jetzt
2/3
der
Führungsarbeit
übernahm
und
das
Fahrwerk
bei
hoher
Geschwindigkeit
wesentlich
ruhiger
zu
fahren
und
in
den
Kurven
feinfühliger
zu
kontrollieren
war.
Damit
das
Vorderrad
trotz
der
Schwerpunktverlagerung
nicht
zu
instabil
wurde,
verbaute
Hofmeister
zwischen
den
vorderen
Gabelrohren
einen
kleinen
Stoßdämpfer.
Man
baute
immer
eine
Serie
von
10
Stück
und
änderte
dann
die
Konstruktion
wenn
sich
neue
Erkenntnisse
ergeben
hatten.
Beim
Hofmeister
Rahmen
endet
das
Sattelrohr
immer
zwischen
Motor
und
Getriebe.
Die
Rahmen
die
das
Sattelrohr
hinter
dem
Getriebe
hatten
wurden
von
Fred
Aberl
gebaut,
da
dieser
das
besser
fand.
Aberls
Rahmen
hatten
auch
den
Öltank
im
Sattelrohr
verbaut,
während
er
beim
Hofmeister
zwischen
den
Rahmenrohren
im
Heck verbaut war. Bei der hinteren Schwingenfederung nimmt eine Spiralfeder die Stöße auf, während ein aus dem VW-Käfer stammender Stoßdämpfer für sanftes Ausfedern sorgte.
Insgesamt
wurden
etwa
30
Fahrgestelle
nach
diesem
Prinzip
gebaut
und
an
Fahrerkollegen
aus
ganz
Europa
verkauft.
Beim
Finale
zur
Europameisterschaft
in
Mühldorf
gingen
damals
11
der
18
Fahrer
mit
einem
Hofmeister
Fahrgestell
an
den
Start.
Hofmeister
selbst
hat
immer
JAP-
Motoren
mit
DROTT
Getriebe
gefahren.
Alle
anderen
Bikes
sind
Umbauten
von
Aberl
oder
irgendwelchen Bastlern.
Manfred Poschenrieders JAP im Hofmeister Fahrgestell





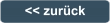

Houghton Juniorbike Bahnsporttechnik.de
Dieses
Juniorbike
mit
98
ccm
Villiers
Motor
steht
im
Murray
Motorcycle
Museum
auf
der
Insel
Man.
Es
handelt
sich
um
einen
Eigenbau
den
ein
Vater
oder
Tuner
für
seinen
Nachwuchs
konstruierte.
Solche
Maschinen
wurden
früher
in
der
Englischen
Liga
verwendet
mit
denen
die
Vereins-
maskottchen
bei
der
Fahrervorstellung
die
Fahrer
zum
Vorstart begleiteten.



HONDA Schwenker Gespann Bahnsporttechnik.de
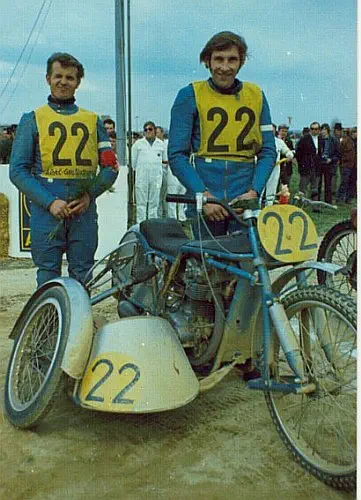
Eines
der
spektakulärsten
Gespanne
der
1970er
Jahre,
war
das
Honda
Schwenker-
Gespann
von
Jürgen
Stein
aus
Dorheim.
In
dem
Eigenbau
Fahrgestell
steckte
er
einen
Zweizylinder
HONDA
CB
450E
Motor
mit
Alkoholeinspritzung.
Der
450
ccm
Motor
wurde
1969
von
Jürgen
Stein
in
mühevoller
Kleinarbeit
auf
500
ccm
aufgebohrt
und
mit
einer
Einspritzanlage
versehen.
Durch
viel
Feinarbeit
konnte
er
die
Leistung
von
ursprünglich
48
PS
auf
weit
über
50
PS
steigern
und
war
damit
der
Konkurenz
mit
ihren
JAP
und
Jawa
Motoren
weit
überlegen.
Nach
vielen
technischen
Problemen
bei
der
Deutschen
Meisterschaft
der
Gespanne
in
München,
im
Jahre
1970
(3.Platz)
folgte
1971
in
Pfarrkirchen
endlich
der
langersehnte
Meistertitel.
Von
nun
an
ging
es
bergauf
und
Jürgen
Stein
gewann
mit
seinem
Co-Piloten
Klaus
Bornträger
fast
alles
was
es
zu
gewinnen
gab.
1972
beim
Endlauf
in
Scheessel
konnten
sie
ihren
Meistertitel
verteidigen.
Acht
Monate
später,
am
Pfingstmontag
1973,
starteten
Stein/Bornträger,
,
beim
Internationalen
Sandbahnrennen
in
Altrip
und
zählten
natürlich
zu
den
Favoriten.
Gleich
im
ersten
Lauf
hatten
sie
nach
einer
Bodenwelle
einen
Aufsteiger
und
Jürgen
fiel
vom
Motorrad.
Ein
nachfolgendes
Gespann
konnte
nicht
mehr
ausweichen
und
überfuhr
den
am
Boden
liegenden
Dorheimer.
Bereits
auf
dem
Weg
zum
Krankenhaus
verstarb
Jürgen
Stein
an
seinen
Verletzungen. Sein Beifahrer Klaus Bornträger blieb bei dem Sturz unverletzt.
Vierzehn Tage nach den schrecklichen Ereignissen in Altrip verbot die FIM Schwenkergespanne bei Bahnrennen.
Bild Links :
Jürgen
Stein
mit
Beifahrer
Klaus
Bornträger
und
der
Zweizylinder
Honda
mit
Einspritzanlage.
Das
Gespann
befindet
sich
heute
im Zweiradmuseum von Heinz Luttringhauser in Ottersbach.

JAWA Oldtimer Bahnsporttechnik.de

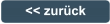

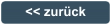




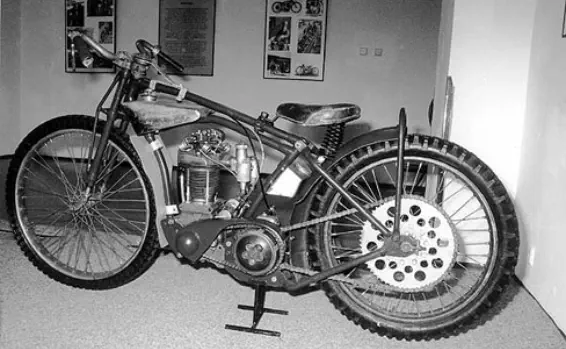
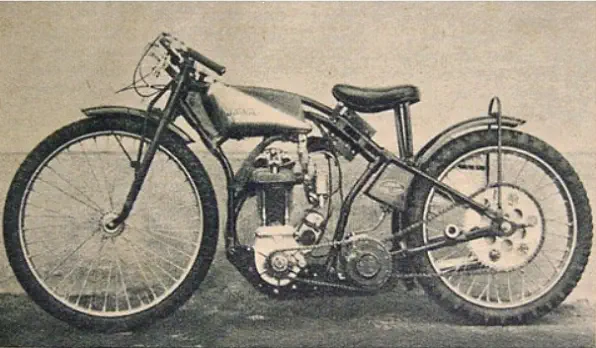
Die erste von Jawa gebaute Speedwaymaschine von 1934
Jawa 350 ccm Speedwaybike von 1935

Jawa 500 mit Königswelle von 1945
JAWA 500 DTC Zweizylinder OHC mit Kompressor von 1945, Gewicht 119 kg


Jawa 891 Eisspeedwaybike von 1969 JAWA 891 DOHC Eisspeedwaybike 1981


Jawa 890 2-Ventil Speedwaybike 1969 Jawa 884 4-Ventil Speedwaybike 1983



Jawa Langbahnbike mit 2-Ventil OHV Motor 1972 Jawa Langbahnbike mit 885 4-Ventilmotor 1980















Bahnsporttechnik.de
Sandbahn, Grasbahn, Speedway und Eisspeedwaytechnik




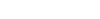
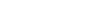
Fahrgestelle